![]()
Das Leben
der mexikanischen Malerin Frida Kahlo kommt in die Kinos. Ästhetisch ist der
Film ein Kunstwerk, inhaltlich lässt er einiges zu wünschen übrig.

Für diese
Szene lohnt sich der Kinobesuch. Nämlich die, als die Malerin Frida Kahlo (Salma
Hayek) mit Tina Modotti (Ashley Judd) die erotischste aller mexikanischen Rumbas
hinlegt. Das alles wegen einer Wette. Tina will Fridas hitzköpfigen Gatten Diego
Rivera (Alfred Molina) vor einer Schlägerei bewahren, indem sie ihn und den
zweiten Streithahn auffordert, so viel Tequila wie möglich in einem Zug zu trinken.
Der Gewinner dürfe mit ihr tanzen. Riviera setzt die Flasche an, sein Gegenüber
macht einen Witz, er lacht und prustet. Der Wettgegner schafft nur ein winziges Schlückchen.
Plötzlich greift aus dem Hinterhalt Frida nach dem hochprozentigen Zeug, trinkt,
trinkt, und trinkt. Dann raunt sie "komm!", greift sich Tina, verschmilzt
mit ihrer Freundin und bricht dabei der Zuschauerin das Herz vor lauter Kühnheit,
Zärtlichkeit und Eleganz.
Mehr allerdings soll das Publikum von der Beziehung zwischen der mexikanischen Malerin
und der Fotografin nicht erfahren. Nichts von dem leidenschaftlichen Band zwischen
den beiden Künstlerinnen. Im wirklichen Leben hat Frida Kahlo Tina Modotti bewundert,
wegen ihr ist sie der kommunistischen Partei Mexikos beigetreten. Das alles zeigt
Regisseurin Julie Taymor in ihrer Künstlerinnenbiografie nicht. Der Tanz, die
Erotik zwischen Frida und Tina könnte in ihrem Spielfilm "Frida" auch
als Rache zu verstehen sein. Rache dafür, dass Gatte Rivera wieder mal nicht
an sich halten konnte und mit Modotti im Bett war.
 Taymor
spannt ihre Geschichte von Frida Kahlo an den Eckpunkten Krankheit, Malerei und Ehe
auf. Im Mittelpunkt die Liebesgeschichte zu Diego Rivera. Leidenschaftlich, wie sie
wirklich war, und ebenso zerstörerisch. Denn Riviera hüpft mit diversen
Frauen durch die Betten, während Frida leidet. Und Konsequenzen zieht. Sie lässt
sich von Rivera scheiden und schneidet ihre Haare. In dieser Zeit entsteht das berühmte
"Selbstbildnis mit abgeschnittenem Haar". Einerseits zeigt sie dem Ex so,
dass sie mit ihm fertig ist. Denn er liebt gerade ihr langes Haar über alles.
Andererseits bezeichnet Frida den Tod als "Pelona", als Kahlköpfige.
Dieser Tod, der sie Zeit ihres Lebens begleitet, seit dem schrecklichen Unfall als
junge Frau mit der Straßenbahn, als sie sich mehrfach Beine und Wirbelsäule
bricht. Drei Monate liegt sie im Bett, eingehüllt in einen Ganzkörpergips.
Dort beginnt sie zu malen. Lässt sich über ihrem Bett einen Spiegel anbringen,
um das Bild beser sehen zu können. Bemalt auch ihren Gips, mit Hammer und Sichel.
Schon in jungen Jahren ist sie eine glühende Verehrerin der kommunistischen
Revolution in Mexiko.
Taymor
spannt ihre Geschichte von Frida Kahlo an den Eckpunkten Krankheit, Malerei und Ehe
auf. Im Mittelpunkt die Liebesgeschichte zu Diego Rivera. Leidenschaftlich, wie sie
wirklich war, und ebenso zerstörerisch. Denn Riviera hüpft mit diversen
Frauen durch die Betten, während Frida leidet. Und Konsequenzen zieht. Sie lässt
sich von Rivera scheiden und schneidet ihre Haare. In dieser Zeit entsteht das berühmte
"Selbstbildnis mit abgeschnittenem Haar". Einerseits zeigt sie dem Ex so,
dass sie mit ihm fertig ist. Denn er liebt gerade ihr langes Haar über alles.
Andererseits bezeichnet Frida den Tod als "Pelona", als Kahlköpfige.
Dieser Tod, der sie Zeit ihres Lebens begleitet, seit dem schrecklichen Unfall als
junge Frau mit der Straßenbahn, als sie sich mehrfach Beine und Wirbelsäule
bricht. Drei Monate liegt sie im Bett, eingehüllt in einen Ganzkörpergips.
Dort beginnt sie zu malen. Lässt sich über ihrem Bett einen Spiegel anbringen,
um das Bild beser sehen zu können. Bemalt auch ihren Gips, mit Hammer und Sichel.
Schon in jungen Jahren ist sie eine glühende Verehrerin der kommunistischen
Revolution in Mexiko.
Rivera auch, und so kommen die Schülerin und der wesentlich ältere angesehene
Revolutionsmaler zusammen. Sie, die Feministin, er der Weiberheld. Regisseurin Taymor
konzentriert sich von nun an mehr auf den Ehemann als auf die Titelheldin selbst:
Seine Arbeit, seine Frauen, seine Karriere. Frida zieht eben mit. Wütend wegen
der vielen Seitensprünge, liebend, weil sie nicht anders kann, bleibt sie in
seinem Schatten. Ihre Gemälde entstehen im Verborgenen, vornehmlich Selbstporträts
mit und ohne Affe. Im Mittelpunkt ihrer Auseinandersetzung mit dem Tod, die lebenslangen
Schmerzen von zig Operationen, das pralle Leben in leuchtenden Farben. Was der Film
auslässt: In Wirklichkeit war Frida Kahlo schon früh eine in der Öffentlichkeit
angesehene Künstlerin und hat 1938 mit ihrer ersten Einzelausstellung in New
York großen Erfolg gefeiert. Ein Jahr später, im Alter von 32 Jahren verkauft
sie dem Louvre in Paris als erste Mexikanische KünstlerIn überhaupt ein
Bild: "der Rahmen". Ihre Ausstellung in Paris gerät zwar zum Flop,
weil die Pariser Gesellschaft sich kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nicht
besonders für mexikanische Bilder interessiert. Die Pariser Surrealisten hingegen
empfangen Frida Kahlo begeistert. Von da an stellt Kahlo immer wieder aus und erhält
diverse Preise. Was der Film von alledem zeigt: Fridas Aufenthalt in Paris, interpretiert
als Emanzipation vom Gatten. Was der Film an dieser Stelle gestattet: Einen One-Night-Stand
mit einer Sängerin in ihrem Pariser Hotel.
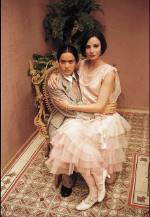 Davon
abgesehen, dass ihre lesbische Seite und Frida Kahlos Karriere zu kurz kommen, gibt
der Film allerdings eine grandios ästhetische Einführung in ihr Werk. Nicht
in seine Vermarktung, die fällt flach, aber in die Umstände der Entstehung
einzelner Bildnisse. Nehmen wir das Selbstporträt "die zwei Fridas".
Da sitzt die Malerin vor ihrer Staffelei und hat gerade den letzten Pinselstrich
getan. Die Kamera zoomt ganz nah heran, so dass das Porträt die Filmleinwand
ausfüllt. Und dann fängt sich die eine gemalte Frida an zu bewegen, steht
auf, schält sich als echter Mensch aus dem Bild heraus und geht hinüber
in die nächste Filmszene. Das ist schön. Sehr schön. Einer der ästhetischsten
Momente des Films. Selbst die schwierige Ästhetisierung des Straßenbahnunfalls
gelingt. Scherben fliegen durch die Luft, ebenso Goldstücke, die ein Passant
eben ausgepackt hat, die Menschen kugeln durcheinander. Alles in Zeitlupe. Im Krankenhaus
nimmt Frida, und aus ihrer Perspektive auch das Publikum, die Ärzte und Schwestern
surreal als Comic-Skelette wahr, mit riesigen Spritzen. Blut fließt. Das Krankenhauspersonal
spricht wie durch einen halb durchsichtigen, blechernen Vorhang. In anderen Szenen
bestechen die Farben, zum Beispiel ganz am Anfang, als die Kamera durch den Innenhof
des elterlichen Hauses in Mexico City fährt. Bunt, lebendig, prall. Blumen,
Tiere. So wie Kahlo später immer wieder gemalt hat: intensiv.
Davon
abgesehen, dass ihre lesbische Seite und Frida Kahlos Karriere zu kurz kommen, gibt
der Film allerdings eine grandios ästhetische Einführung in ihr Werk. Nicht
in seine Vermarktung, die fällt flach, aber in die Umstände der Entstehung
einzelner Bildnisse. Nehmen wir das Selbstporträt "die zwei Fridas".
Da sitzt die Malerin vor ihrer Staffelei und hat gerade den letzten Pinselstrich
getan. Die Kamera zoomt ganz nah heran, so dass das Porträt die Filmleinwand
ausfüllt. Und dann fängt sich die eine gemalte Frida an zu bewegen, steht
auf, schält sich als echter Mensch aus dem Bild heraus und geht hinüber
in die nächste Filmszene. Das ist schön. Sehr schön. Einer der ästhetischsten
Momente des Films. Selbst die schwierige Ästhetisierung des Straßenbahnunfalls
gelingt. Scherben fliegen durch die Luft, ebenso Goldstücke, die ein Passant
eben ausgepackt hat, die Menschen kugeln durcheinander. Alles in Zeitlupe. Im Krankenhaus
nimmt Frida, und aus ihrer Perspektive auch das Publikum, die Ärzte und Schwestern
surreal als Comic-Skelette wahr, mit riesigen Spritzen. Blut fließt. Das Krankenhauspersonal
spricht wie durch einen halb durchsichtigen, blechernen Vorhang. In anderen Szenen
bestechen die Farben, zum Beispiel ganz am Anfang, als die Kamera durch den Innenhof
des elterlichen Hauses in Mexico City fährt. Bunt, lebendig, prall. Blumen,
Tiere. So wie Kahlo später immer wieder gemalt hat: intensiv.
Regisseurin Taymor versteht es, den surrealistischen Stil Kahlos als ästhetisches
Mittel in die Filmbilder einfließen zu lassen. Rivieras Ruf nach New York,
um das Rockefeller Center zu bemalen beispielsweise, indem Kahlo und Rivera durch
eine Wolkenkratzerlandschaft aus grauem Pappmachee spazieren. Wie eine lebendige
Collage. Die Kunst im Film und der Film als Kunst. Die Bilder sind phantastisch,
lohnen sich und beeindrucken. Sie bewegen sich jenseits jeden Hollywood-Klischees.
Auch wenn die Handlung geradezu zur Tranendrüsen-Interpretation einlädt,
rutscht die Inszenierung nicht ins Klischee, als die schwer kranke Kahlo kurz vor
ihrem Tod in ihrem Himmelbett zur Vernissage ihrer Einzelausstellung in Mexiko City
erscheint. Das liegt zum großen Teil an der Kameraführung, die keine Sehgewohnheiten
bedient. Aber auch Frida-Mimin Salma Hayek versteht es, trotz aller Dramatik, nicht
in Gefühlsduselei abzugleiten. Sie bietet dem Publikum nicht die Chance, zum
Taschentuch zu greifen.
Mit der spektakulären Transportszene beginnt der Film. Die Kamera blickt von
oben auf die liegende Frida herab. Nimmt ihr Gesicht ganz nah, ein schmerzverzerrtes
Gesicht, von dem Gerüttel auf dem Wagen. Mit dem Himmelbett mitten in der Ausstellung
endet der Film. In Echtzeit eine halbe Stunde später, in Filmzeit liegt ein
genzes Künstlerinnenleben dazwischen. Frida greift glücklich zum Tequilaglas.
Gleichzeitig verspricht sie ihrem Arzt, von nun an nicht mehr zu trinken. "Das
ist ein Wort", schmunzelt er. Wissend, dass die Malerin sowieso nur noch eine
kurze Zeit zu leben hat. Ein still schweigendes Einverständnis zwischen den
beiden. Im Jahr nach der Ausstellung, 1954, stirbt Frida Kahlo 47-jährig im
Schlaf. Das deutet Regisseurin Taymor nur an, mit einer filmischen Collage auf der
Grundlage des kahloschen Selbstbildnisses "Der Traum oder Das Bett": Frida
schläft in ihrem Himmelbett, der Tod als Skelett ruht über ihr auf dem
Baldachin. Das Bett schwebt, aber es trägt mit sich dornige Pflanzen, die die
schlafende Frida halb würgend, halb zärtlich umschlingen. So weit zur Künstlerin
Frida Kahlo.
Was die politische Aktivistin Frida Kahlo betrifft, so sei an dieser Stelle erwähnt,
dass sie sich weit mehr für die kommunistische Revoloution in Mexiko engagiert
hat als der Film ihr zugesteht. Breit tritt der die kurze Affäre mit Leo Trotzki,
der mit seiner Frau Natalia bei dem Ehepaar Kahlo-Rivera Asyl genießt, als
Stalin ihn verfolgt. Dabei ist Kahlo mehr als nur die Liebhaberin eines alternden
kommunistischen Intellektuellen gewesen. Überzeugt von den marxschen Schriften
trat sie öffentlich für die Rechte der Armen und für trotzkistische
Ideale ein. Noch kurz von ihrem Tod, gerade von einer Lungentzüngune genesen
und ein halbes Jahr nach der Amputation eines Beines, nahm sie an einer Demonstration
gegen den Sturz der guatemaltekanischen Regierung teil. Unerwähnt lässt
die Filmbiografie auch, dass Kahlo ab 1943 als Dozentin an der Maler- und Bildhauerakadmie
in Mexico City arbeitete. Kahlo entwickelt dort ihren eigenen Lehrstil. Ihr kommt
es darauf an, den Studierenden ihre Liebe zur Alltagswirklichkeit zu vermitteln:
Ihre Neugier auf das Alltägliche, die Kunst, sich beeindrucken zu lassen. Diese
sinnliche Identifikation mit der mexikanischen Kultur, den Sitten und Bräuchen,
den Lebensumständen war für Kahlo die Voraussetzung für den Griff
zum Pinsel. Sie verband ihr politisches Engagement mit ihrer Lehrtätigkeit unter
anderem dadurch, dass sie auf Ausflügen mit den Studierenden mexikanische Revolutionslieder
sang. Mit einer kleinen Gruppe Studierender, den "Los Fridos" pflegte sie
über den Unterricht hinaus Kontakt. Sie aßen zusammen, sie diskutierten
miteinander und gingen gemeinsam ins Kino.
Für die Filmbiografie "Frida" ins Kino zu gehen lohnt sich vor allem
wegen der ästhetischen Elemente, der Farben, der Collagen, der Kamerablicke.
Salma Hayek glänzt in ihrer Rolle. Zu Hause bleiben sollte, wer mehr von Frida
Kahlo erfahren möchte, als dass sie schön, unerschütterlich und in
erster Linie die Frau von Diego Rivera war.
Katrin Jäger
"Frida" startet am 6. März in den bundesdeutschen Kinos.
Photos: Peter Sorel, Miramax